Mit Tarifvergleichen können Verbraucher sehr viel Geld sparen!
| 08581 – 726 28 55 Mo. – Fr. 9:00 – 19:00 Uhr |
|
|
Onlineberatung Kostenlosen Termin vereinbaren |
|
| info@onverso.de Kontaktformular |
Beliebte Ratgeber
Wie hoch ist der Arbeitgeberzuschuss für die private Krankenversicherung 2024?
Wer als Angestellter in die private Krankenversicherung wechselt, erhält von seinem Arbeitgeber einen steuerfreien Zuschuss zu seiner PKV. mehr lesen…
Ist eine Private Rentenversicherung sinnvoll, oder nicht?
Eine private Rentenversicherung ist für viele Verbraucher das Mittel der Wahl, um sich zusätzlich eine Altersvorsorge aufzubauen. mehr lesen…
Alles Wichtige zur staatlichen und privaten Berufsunfähigkeitsrente!
Der Gesetzgeber hat den Anspruch auf die staatliche Berufsunfähigkeitsrente im Jahr 2001 für alle Bürger, die nach dem 01.01.1961. mehr lesen…
Was wir für Sie tun
Wer für sich eine passende Geldanlage, Versicherungen oder Bankprodukte sucht, ist bei uns genau richtig. Wir unterstützen Verbraucher bei der Wahl des richtigen Tarifs. Über unsere kostenlosen Vergleichsrechner haben Sie die Möglichkeit sich einen ersten Überblick im Finanz- und Versicherungsdschungel zu verschaffen. In den Tarifvergleichen sind viele namhafte und geprüfte Anbieter vertreten.
Darüber hinaus finden Sie bei uns jede Menge redaktionelle Beiträge rund um Versicherungs- und Finanzthemen. Wer möchte, kann sich zu verschiedenen Themen direkt online beraten lassen. Wir arbeiten 100 % neutral und stehen ausschließlich auf der Seite unserer Kunden. Mit unserer über 15-jährigen Erfahrung finden wir für jeden den passenden Tarif und können dabei noch mehrere tausende Euro pro Jahr einsparen.
Ihre Vorteile
- Ersparnisse von mehreren Tausend Euro pro Jahr möglich
- 100 % kostenlose und unverbindliche Vergleiche
- Auf Wunsch persönliche Beratung
- Experten Know-How aus über 15 Jahren Berufserfahrung
- Garantiert 100 % neutrale Vergleiche
Wie wir unser Geld verdienen
Die Nutzung unseres Vergleichsportals ist für Verbraucher zu 100 % kostenlos und unverbindlich. Wir erhalten bei einer Vermittlung eines Versicherungs- oder Finanzprodukts eine Provision vom jeweiligen Anbieter. Für Verbraucher wichtig zu wissen: Durch den Erhalt der Provision bleibt der Preis für Sie gleich und ändert sich dadurch nicht.
Unsere Vergleiche
Für diese Versicherungssparten stellen wir kostenlose Vergleichsrechner zur Verfügung:
- Haftpflichtversicherung: Die private Haftpflichtversicherung gehört zu den wichtigsten Versicherungen überhaupt. Denn wer einem Dritten einen Schaden zufügt, muss dafür unbegrenzt mit auch über sein komplettes Vermögen hinaus haften. Bei größeren Schäden kann schnell die Privatinsolvenz drohen. Eine günstige Privathaftpflichtpolice können Singles bereits ab 35 € pro Jahr abschließen. Familien zahlen etwas mehr, da alle Familienmitglieder versichert werden. Günstige Familientarife beginnen bei einer Jahresprämie von ungefähr 45 €. Aufgrund der überschaubaren Prämien sollte jeder über eine Privathaftpflicht abgesichert werden.
- Hausratversicherung: Nach einem Wohnungsbrand kann es schnell teuer werden. Wer seinen kompletten Hausrat einmal zusammenzählt, kommt meist auf eine sehr hohe Summe. Nicht selten liegt der Wert bei 50.000 € und mehr. Denn nicht nur Möbel, sondern auch Kleidungsstücke, Elektronik, Geschirr und Wertsachen zählen zum Hausrat. Einfach erklärt, alles was nicht fest mit der Wohnung verbunden ist. Bei Schäden am Hausrat die aufgrund von Feuer, Leitungswasser, Einbruch sowie Sturm- und Hagel entstehen, ersetzt diese Versicherung den Neuwert. Bei einem Tarifvergleich können Verbraucher jede Menge Geld sparen. Denn die Versicherungsprämien sind vom Wohnort abhängig und jeder Anbieter kalkuliert das Risiko anders. Preisunterschiede von bis zu 80 % sind in der Hausratversicherung keine Seltenheit.
- Rechtsschutzversicherung: Es gibt immer wieder Situation in welchen Verbraucher rechtlichen Beistand benötigen. Sei es nach einem Verkehrsunfall oder durch eine ungerechtfertigte Kündigung durch den Arbeitgeber. Auch Probleme mit dem Vermieter oder den Nachbarn können vor Gericht enden. Eine Rechtsschutzversicherung übernimmt die Anwalts- und Gerichtskosten für den Fall, dass Verbraucher ihr Recht einklagen müssen. Ein kompletter Schutz für die Bereiche; Privat, Beruf, Verkehr sowie für Miete und Eigentum ist bereits ab ungefähr 180 € pro Jahr zu haben. Unser kostenloser Vergleichsrechner unterstützt Verbraucher bei der Wahl des richtigen Tarifs.
- Unfallversicherung: Nach einem Unfall, aus welchem eine dauerhafte Invalidität hervorgeht, wird in der Regel Kapital benötigt um verschiedene Umbaumaßnahmen in der Wohnung oder an seinem Kfz vorzunehmen. Zudem kann es vorkommen, dass man auf Dauer eine Einnahmequelle benötigt, da der Job aufgrund des Unfalls nicht mehr ausgeübt werden kann. In solchen Fällen leistet die Unfallversicherung entweder eine bestimmte Summe oder eine sogenannte Unfallrente. Beide Varianten können getrennt oder gemeinsam abgeschlossen werden. Die Prämien sind abhängig von der beruflichen Tätigkeit sowie der Höhe der versicherten Leistungen. Mit Hilfe unseres kostenlosen Vergleichsrechners können Verbraucher schnell und einfach die Prämien der unterschiedlichen Versicherer vergleichen.
- Wohngebäudeversicherung: Ein Haus gehört zu den größten Investitionen im Leben eines Menschen. Aus dem Grund ist es äußerst wichtig, dass man sich vor Risiken wie beispielsweise Feuer, Sturm oder Hagel und Schäden die Leitungswasser verursachen kann, schützt. Auch Hochwasser ist immer wieder der Grund weshalb Menschen ihr Zuhause verlieren. Mit einer Wohngebäudeversicherung können Verbraucher diese Risiken versichern. Auch in diesem Bereich kalkulieren die Versicherer die Risiken unterschiedlich und das können sich Verbraucher zunutze machen, indem sie die Tarife mit unserem Gebäudevergleichsrechner vergleichen.
- Kfz-Versicherung: Jeder Fahrzeughalter muss sein Auto mindestens gegen Haftpflichtansprüche eines Dritten versichern. Viele Verbraucher möchten ihr Auto darüber hinaus gegen weitere Risiken, wie beispielsweise Diebstahl oder Wildschäden versichern. Je nach Leistungsumfang wird dafür eine Teilkasko oder Vollkaskoversicherung benötigt. Ein Kfz-Tarifvergleich kann einem über 1.000 € pro Jahr an Versicherungsprämien sparen. Oftmals ohne auf wichtige Leistungen zu verzichten.
- Motorradversicherung: Genau wie bei der Autoversicherung, müssen Motorradhalter mindestens eine Motorradhaftpflichtversicherung abschließen. Beliebt ist aber auch eine zusätzliche Teil- und Vollkaskoversicherung. Mit unserem kostenlosen Motorradvergleichsrechner kann man schnell und einfach die Versicherungsprämien vergleichen.
- Tierhalterhaftpflichtversicherung: Wer Tiere, wie beispielsweise einen Hund oder ein Pferd hält, muss für Schäden, welche die Tiere verursachen haften. Auch hier gilt, dass die Haftung im Extremfall über das private Vermögen hinausgeht. Aus dem Grund sollte jeder Besitzer von Hunden oder Pferden eine Tierhalterhaftpflichtversicherung abschließen. Die Prämien sind abhängig von der jeweiligen Rasse und dem Alter des Tieres. Unser Vergleichsrechner zeigt in wenigen Minuten ein individuelles Ergebnis an.
Bei den beratungsintensiveren Versicherungen erstellen wir die Tarifvergleiche kostenlos und unverbindlich via Onlineberatung:
- Berufsunfähigkeitsversicherung: Die persönliche Arbeitskraft ist bei den meisten Menschen das höchste Gut. Denn damit wird im Schnitt über das ganze Arbeitsleben circa 1,5 Mio. € erwirtschaftet. Wer aufgrund einer längeren Krankheit oder eines Unfalls ausfällt, wird ohne großes finanzielles Polster früher oder später in die Sozialhilfe abrutschen. Mit Hilfe einer Berufsunfähigkeitsversicherung haben Verbraucher die Möglichkeit sich gegen die Risiken eines längeren Verdienstausfalls aufgrund einer Erkrankung abzusichern. Verbraucher erhalten in dem Fall die mit dem BU-Versicherer vereinbarte Berufsunfähigkeitsrente. Da die Tarife zu den teureren Versicherungsprodukten zählen, ist es sinnvoll vor dem Abschluss einen umfassenden Marktvergleich durchzuführen. Unsere Expertensoftware berücksichtigt alle BU-Tarife, die sich derzeit am Markt befinden.
- Private Krankenversicherung: Gut verdienende Angestellte, Beamte und Selbständige haben die Möglichkeit in die private Krankenversicherung zu wechseln. In der Regel erhalten sie dort eine bessere medizinische Versorgung als bei der gesetzlichen Krankenkasse. Zudem kann der Versicherungsschutz individuell zusammengestellt werden. Wer arbeiten in diesem Bereich mit einer sehr professionellen Vergleichssoftware, um die besten PKV-Tarife zu filtern.
- Krankenzusatzversicherung: Auch gesetzlich Krankenversicherte können sich für bestimmte medizinische Bereiche höherwertig versichern. Ob im Krankenhaus oder für Behandlungen durch den Heilpraktiker. Eine Krankenzusatzversicherung übernimmt je nach Tarif die Mehrkosten der Behandlungen. Da die es in diesem Bereich eine sehr umfangreiche Tarifwelt gibt, ist es für Verbraucher sinnvoll sich vorab über die Möglichkeiten zu informieren. Am besten geht das über einen Tarifvergleich.
- Zahnzusatzversicherung: Zahnbehandlungen werden von der gesetzlichen Krankenkasse heutzutage kaum noch bezahlt. Der Anteil, welcher Erstattet wird, liegt regelmäßig bei unter 20 % der beim Zahnarzt anfallenden Kosten. Es ist leider nicht selten, dass eine Zahnbehandlung tausende von Euro kostet. Eine Zahnzusatzversicherung beteiligt sich je nach Tarif an diesen Kosten bis zu 100 %. Am Markt gibt es allerdings hunderte von Tarifkombinationen. Für Verbraucher ist das oft schwer, die Unterschiede exakt zu erkennen. Unser Tarifvergleichsrechner berücksichtigt nicht nur sämtliche Anbieter, er erstellt anhand eines im Vorfeld definierten Leistungsprofils einen aussagekräftigen Zahnzusatzvergleich.
- Pflegezusatzversicherung: Das Risiko als Pflegefall aus dem Leben zu gehen, ist enorm hoch. Die Kosten für eine Pflege zu Hause oder einem Pflegeheim übersteigen bei weitem die Leistung, welche von der gesetzlichen Pflegeversicherung übernommen werden. Den Rest müssen Verbraucher aus ihrer eigenen Tasche bezahlen. Die Pflegezusatzversicherung gehört aus dem Grund zu den wichtigsten Versicherungen überhaupt. Sinnvoll ist es, bereits in jungen Jahren einen geeigneten Tarif abzuschließen. Denn die Prämien sind dann noch günstig und der Gesundheitszustand in der Regel noch gut genug. Denn beim Vertragsabschluss wird eine Gesundheitsprüfung durchgeführt.
- Altersvorsorge: Vielen Verbrauchern ist zwar bewusst, dass sie etwas für das Alter sparen müssen, allerdings fällt ihnen die Auswahl des passenden Produkts sehr schwer. Aus dem Grund bieten wir speziell für die Altersvorsorge eine ausführliche Beratung an, in welcher die passenden Möglichkeiten ermittelt werden.
- Private Rentenversicherung: Bei der Altersvorsorge geht es um die Absicherungsdauer Einkommenslücke im Rentenalter. Diese Absicherung kann ausschließlich die private Rentenversicherung bieten. Während die klassische private Rentenversicherung in den letzten Jahren aufgrund der weltweit fallenden Zinsen, an Bedeutung verloren hat, setzten Verbraucher mittlerweile verstärkt auf fondsgebundene Rentenversicherungen. Der Vorteil dieser Policen liegt darin, dass die Kunden zu Rentenbeginn entscheiden können, ob sie sich das Kapital lebenslang verrenten lassen, oder den angesparten Betrag als einmalige Kapitalauszahlung erhalten. Auf Garantien müssen sicherheitsorientierte Verbraucher auch nicht verzichten. Auf Wunsch werden auch Kapitalerhaltungsgarantien bei fondsgebundenen Rentenversicherung ausgesprochen. Idealerweise sollte man die privaten Rentenversicherungen vor dem Abschluss vergleichen, um einen Tarif mit einem guten Preis-Leistungs-Verhältnis zu finden.
- Riester Rente: Diese Art der Altersvorsorge ist in den letzten Jahren stark in die Kritik geraten. Grund sind vor allem überteuerte Riester-Renten-Tarife, die den Versicherten nach Kosten keine auskömmliche Verzinsung mehr bieten. Fakt ist, dass nicht jeder Tarif davon betroffen ist. Gerade fondsgebundene Riester-Renten haben für ihre Kunden im Vergleich eine ordentliche Rendite erwirtschaftet. Vor allem, wenn man bedenkt, dass die Tarife eine echte Kapitalerhaltungsgarantie zum Ende der Laufzeit bieten müssen. Für viele Verbraucher ist die Riester Rente mit dem richtigen Tarif eine lohnenswerte Altersvorsorge. Damit Sie auch den passenden Riester-Renten-Tarif finden, bieten wir einen unabhängigen Vergleich, welcher von unserer Expertenvergleichssoftware erstellt wird an.
- Rürup Rente: Diese Vorsorgeform eignet sich vor allem für Selbständige, Beamte und gut verdienende Angestellte. Die Rürup Rente funktioniert vom Prinzip genau wie die gesetzliche Rentenversicherung, mit dem Unterschied, dass es sich hier um einen Vertrag handelt, welcher die Beiträge individuell für die Versicherten anspart. Bei der gesetzlichen Rentenversicherung erwerben die Versicherten sogenannte Rentenpunkte, es wird aber nichts für sie angespart. Anders ist das in der Rürup Rente, in welcher Kunden das Kapital auf Wunsch sogar mit Investmentfonds und ETFs aufbauen können. Welcher Weg im Vergleich, der Richtige ist, kann man pauschal nicht beantworten. Für den einen sind die sicheren Tarife geeignet, andere möchten mehr Chancen auf Rendite und entscheiden sich für eine fondsgebundene Rürup Rente. Doch eines sollten Verbraucher immer vor dem Abschluss machen; die Tarife vergleichen. Auch in diesem Segment erstellen wir mit einem hochwertigen Vergleichsrechner aussagekräftige Tarifvergleiche.
Mit den Ergebnissen der Tags- und Festgeldvergleichsrechner erhalten Verbrauchern schon mal einen ersten Überblick zur Höhe der Zinsen und Sicherheit der jeweiligen Bank. Über den Vergleichsrechner gelangen Verbraucher auch direkt auf die Webseite der einzelnen Anbieter, wo man sich weiter informieren und bei Bedarf auch ein Konto eröffnen kann.
Für ein Girokonto oder eine Kreditkarte müssen Verbraucher heute nicht mehr so hohe Gebühren wie früher bezahlen. Viele Angebote sind sogar komplett kostenlos. Welche Bankprodukte besonders günstig sind, können Sie über unsere Vergleichsrechner in wenigen Minuten ermitteln.
Unser kostenlose Depotvergleichsrechner soll Anlegern aufzeigen, wo sie besonders günstig Wertpapiere, Investmentfonds und ETFs handeln können.
Wer bei der Geldanlage mangels Zeit und Wissen nicht selbst tätig werden möchte, hat über unsere geprüfte ETF-Vermögensverwaltung die Möglichkeit sein Geld von einem der weltweit führenden Kapitalanlagegesellschaften – der DWS – verwalten zu lassen. Und das zu günstigen Konditionen ohne Ausgabeaufschlag und ohne Depotgebühr – nur mit einer transparenten Servicegebühr.


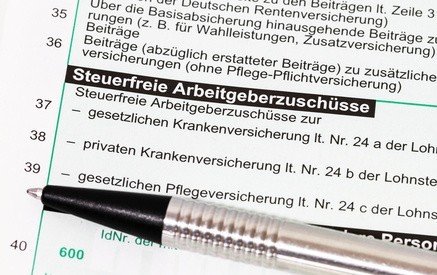


Sie brauchen einen professionellen Rat zu Geldanlagen, Versicherungen und Finanzen? Wir unterstützen Sie gerne mit einem neutralen Vergleich und über 20 Jahre an Erfahrung.